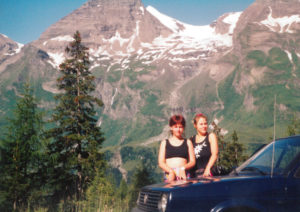Das Berliner Kollektiv She She Pop beschäftigt sich mit dem Verlust der gemeinsamen Wirklichkeit und stellen anderen Sichtweisen, verschreiben sich der Unsicherheit und widmen sich dem Vergessen. Im Durcheinander der Möglichkeiten, der zufälligen Wirklichkeit finden wir uns im großen Saal des Festspielhauses Hellerau wieder.
„Bullshit“ greift gesellschaftliche Probleme spielerisch auf und verpackt sie auf komödiantische Weise in eine Hülle aus Ironie, Leichtsinn und jede Menge Spaß. She She Pop, vertreten durch Sebastian, Ilia, Lisa und Mieke, beginnen das Stück direkt, während Eintreten des Publikums, welches von ihnen be(ob)achtet und kommentiert wird. Mit dem Satz „Ich weiß, dass …“ öffnen sie einen sicheren Raum voll zufälliger Wahrheiten und unendlichen Möglichkeiten. Zum bemerkbaren Beginn der Performance ziehen sie nun eine metaphorische Grenze zwischen Publikum und Schauspielern, zwischen Realität und Fiktion. Diese Grenze wird während des Stückes allerdings mehrmals überschritten und die Wirklichkeit trifft auf Fantasie und Surrealismus. Es entstehen immer wieder Momente der Überraschung und Überforderung, beispielsweise durch die Nacktheit einer Performerin oder dadurch, dass plötzlich alle gemeinsam Leonard Cohens „Everybody Knows“ singen. Durch die Einbindung des Publikums wird ein gemeinsamer Raum geschaffen, in welchem gefühlt alles möglich ist — beispielsweise das Versteigern einer Säule oder der Echtheit einer Performerin. Die eigene Meinung gabs praktisch gratis zu ergattern. Mit viel Witz und Improvisation wird das Publikum schon in der ersten Szene animiert, für jeweils 4,99€, vermeintlich banale Dinge zu kaufen. Aber sind diese wirklich so banal und weit hergeholt oder steckt hinter der Fassade ein tieferer Gedanke, den es für einen Fünfer zu kaufen gibt? Immerhin haben die Performer*innen festgestellt, dass wir in einem System leben, indem wir uns ständig verkaufen müssen. So steht die Säule für Sicherheit und Standfestigkeit, die Echtheit der Performerin für das ehrliche Bekennen des eigenen Selbst. Es gibt den Boden der Tatsachen, die eigene Meinung, eine sehr angepriesene Sichtweise auf das Leben — alles, was für wichtig empfinden werden könnte und eine gute Basis für ein durchschnittliches Leben darstellt. Am Ende wurde sogar das eingenommene Bargeld an einen Menschen versteigert, um zu zeigen, wie schnell Dinge ihren Wert verändern können. Trotz dessen, dass viel gekauft wurde, bleibt auch einiges auf der Bühne, alles wollten die Performer*innen dann doch nicht hergeben.
Trotz einer klaffenden Leere auf der Bühne sind da noch immer die 4 Protagonist*innen. Sie teilen sich das Rampenlicht mit den drei Nebendarsteller*innen: eine Pflanze, eine große Lampe und einen sich drehenden Spiegel. Alle drei haben eigene „Stimmen“, welche zusammen Teile von „Everybody Knows“ singen, allerdings sehr verzerrt und nur schwer zu erahnen. Vielen wurde es erst im Publikumsgespräch im Anschluss bewusst. Das Verzerren der Stimme spielt auch im weiteren Verlauf des Stückes eine entscheidende Rolle, ob es während dem Singen ohne Nachahmen von Tieren ist. Die Tiere, oder besser: die Interviews mit ihnen sind Thema der zweiten Szene. In dieser wird ein neuer Raum aufgemacht, um herauszufinden, welche gemeinsame Wirklichkeit mit den Tieren zu vereinbaren ist. Dafür werden verschiedene Tiere interviewt, welche von Lisa gespielt und von Sebastian synchronisiert werden. Diese versuchen den Menschen klarzumachen, dass die Menschheit Schuld an der Zerstörung des Paradises und Verfremdung der Tiere und Menschen hat. Laut dem Biber haben Tiere nämlich früher einmal mit Menschen geredet. Auch Zecke und Schaf sind nicht unbedingt gut auf die Menschen zu sprechen. Tiere und Menschen sind also vermeintlich nicht mehr kompatibel und trotzdem finden sie Gemeinsamkeiten: mit dem Biber teilen wir uns den Dammbau und mit der Zecke unser Blut. Als eine Art Versöhnungsversuch singen sie – wer hätte es gedacht – „Everybody knows“.
Die Tierinterviews gehen schnell über in eine Dunkelszene. Wir sind nun in der dritten Szene, in der Tierwelt angekommen und sehen uns immer mehr mit Chaos, dem wortwörtlichen Durcheinander der Möglichkeiten konfrontiert. Mittlerweile haben die Darsteller*innen eine Metamorphose durchgemacht und inszenieren nun die bereits interviewten Tiere. Angelehnt an die Thematik einer Fotofalle von Wildfotograf*innen oder Jäger*innen bewegen sich She She Pop durch den Raum und müssen von einer Nachtsichtkamera eingefangen werden. Sie erleben nun die Welt, durch die Augen der Tiere und ganz für sich allein. Es ist schwer, während dieser Inszenierung viel zu verstehen und sich ein Bild von der Thematik zu machen, weil das Sichtfeld ist, oh Wunder, dunkel und wir erhaschen nur impulsartig Blicke auf die Tiere auf der Bühne. Um den Kreis zu schließen und wieder etwas mehr in unsere eigene Wirklichkeit aufzutauchen, schließt She She Pop ihre Performance, wie am Anfang schon, mit Leonard Cohens „Everybody Knows“. Die menschliche Sprache wird nun wieder in das Stück einsortiert und das anfängliche Gemeinschaftsgefühl erfüllt den Raum. Das Lied zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Stück und bietet halt in dem wunderbaren Chaos dessen.
In einem Publikumsgespräch nach der Vorstellung hat das Publikum die Möglichkeit, gesehenes zu Verarbeiten und aufkommende Fragen direkt an das Kollektiv zu stellen. Wir lernen viel über die Arbeitsweise und den Probenprozess des Stückes, aber auch einige Hintergrundgedanken werden erläutert. So wird beispielsweise erklärt, dass die Nacktheit von einer (später auch zwei) Performerin(nen) die aufrechterhaltende Fassade unserer Gesellschaft spiegeln soll. Von vorne sieht alles ganz normal aus, aber hinten rum kommt es ganz anders als gedacht. Auch in einem, von She She Pop geleiteten Workshop bekommen Teilnehmende einen tiefen Einblick in die arbeit des Berliner Kollektivs, wie sie miteinander arbeiten und bekommen so nochmal ein ganz anderes Gefühl für die Arbeit She She Pops.
Zusammenfassend empfehlen wir „Bullshit“ allen, die einen verwirrenden und gesellschaftskritischen Abend erleben wollen, sich in ihren eigenen Möglichkeiten verlieren wollen, nach einem Theaterstück suchen, das noch lange im Kopf nachhallt oder allen, die den Boden unter unseren Füßen für 4,99€ kaufen wollen!
Ein Text von Charly Harazim, Helene Lindicke und Tanita Gola